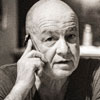Vita

Fotos (Farbe): © Katja-Julia Fischer
Fotos s/w: © Ludger Weß 2020
Didi Danquart ist 1955 in der Industriestadt Singen am Hohentwiel geboren und dort aufgewachsen.
1965 – 1970 erste visuelle Ausbildung durch (zeit)intensive Comicstudien von Sigurd, Ivanhoe, über Donald Duck zu Tim und Struppi bis Bat- Super- und Spiderman bei der Großmutter im Zeitungskiosk.
Ab 1978 Mitbegründer der „Medienwerkstatt Freiburg“. Infolge dessen engagierte politische, gegenöffentliche Arbeit durch die neu aufgekommene analoge Videotechnologie und autodidaktische Film/Ausbildung mit dem Schwerpunkt Dokumentarfilm.
Ab 1983 hauptberuflich "Filmemacher" im Kollektiv bis 1991. In dieser Zeit realisierte er über 20 lange Dokumentarfilme, vorwiegend in der Brd, Süd- und Mittelamerika, sowie zunehmend in Osteuropa und auf dem Balkan.
1992 entstand über die filmische Euthanasiepropaganda der Nazi - erstmals unter seiner eigenen Autorenschaft - das preisgekrönte Kino-Essay Der Pannwitzblick und ein Jahr später - im belagerten Sarajewo - der Antikriegsfilm Wundbrand (zusammen mit dem Auteur und Kameramann Johann Feindt), der auf dem 24. Internationalen Forum des jungen Films seinen Release hatte.
1995 gibt Danquart sein Spielfilmdebüt mit der Schwarzwaldgroteske Bohai Bohau. 1999 folgt die Verfilmung des Theaterstückes Viehjud Levi von Thomas Strittmatter, mit dem ihm der internationale Durchbruch gelang und u.a. den „Caligari Preis“ auf der Berlinale, sowie den Preis des Bürgermeisters auf dem Int. Filmfestival von Jerusalem gewann.
Der Kino-Spielfilm ist, zusammen mit Offset (2006 in Bucarest/Rumänien) und Bittere Kirschen (2011 in Oswiciem / Polen) Teil einer filmischen Trilogie, mit dem Titel Deutsche Conditio Humana I – III, die - neben den beiden genannten Dokumentarfilmen - das Zentrum seines bisherigen Œuvre bildet.
Von 2001 bis 2007 lehrte er hauptberuflich „künstlerischen Film“ an der Hochschule für Gestaltung (HfG) in Karlsruhe. Von 2009-2021 hatte Didi Danquart eine Professur für Spielfilm/Regie an der Kunsthochschule für Medien (KHM) in Köln inne. Seit 2022 hat er einen Lehrauftrag für Filmgeschichte/ Analyse/ Theorie an der IFS Köln/ Masterclass-Studiengang Film. 2022 beteiligte er sich als Lehrender an der summerschool frontier zones in Brasilien/ Manaus.
Im Laufe seines visuellen Schaffens kehrte Didi Danquart immer wieder auf die Theaterbühne zurück, um in (meist politischen) Inszenierungen u.a. seinen Umgang mit Schauspielern und deren Methodiken zu erforschen, sowie die Spielwirkungen im drei-dimensionalen Raum auszuprobieren (Auswahl): 2000 Ritter, Dehne, Voss von Thomas Bernhard; 2001 Beast on the moon von R. Kalinofski über den armenischen Genozid; 2003 Vermummte von Ilan Hatsor über den palästinischen- israelischen Bürgerkrieg und 2014 Die Antrittvorlesung über die SS-Vergangenheit des Romanisten und Hermeneutikers Hans-Robert Jauß. Zuletzt inszenierte er 2018 im Theater Konstanz Von Menschen und Mäusen von John Steinbeck (in einer eigenen modernisierten Fassung).
Durch seine Arbeit an der KHM wendete er sich in den letzten Jahren wieder verstärkt den „Subgenres“ des Fernsehspieles zu. 2012 drehte er den Kammerspielthriller Das letzte Wort des österreichischen Autors Paul Hengge und 2015/16 die philosophische "Pulp Story“ Goster, in dem er mit gezeichneten Comics aktiv in die Diegese des Stoffes eingriff. Außerdem entstanden in den zeitlichen Zwischenräumen zwei experimentelle Kurzfilme unter seiner Regie (Roberto Ciuli - der fremde Blick und Uprising - über Zensur).
In jüngster Zeit lag zudem sein freiberuflicher Schwerpunkt mehr auf dem Schreiben von Filmstoffen (Script) und kleineren Essays. So entstanden in rascher Folge die fiktionalen Drehbücher: Goldfrauen (über illegale Migranten in der Brd, 2017); Raabe Baikal (eine Adaption des 1990 erschienen Romanes von Thomas Strittmatter, 2018/19); das dokumentarische Drehbuch Hausmeister im KZ in Zeiten des Vergessens (2021) und zuletzt das Treatment Lilly of Luxembourg / rewrite (2023).
Zusätzliche Mitarbeit bei filmischen Projekten waren u.a.: dramaturgische Mitarbeit am SWR -Tatort-Drehbuch Braut&Schwester (2021 - 23) und dem öster. Dokumentarfilm Motorcity (2021); bei dem Spielfilm Amitie von Peter Ott / Ute Holl (2022); KNOFO -Gespräche (2023 / 67 Min.));
Essay-Texte von ihm sind in diversen Publikationen erschienen (u.a. in "Klaus Mann Der Kaplan" im Verlag Wallstein; "Der Radikale – Christian Geisslers Literatur" / Verbrecherverlag; "Sich Sehen" / Galiani Verlag; "Arbeit mit Schauspielern" / Alexander Verlag u.a.)